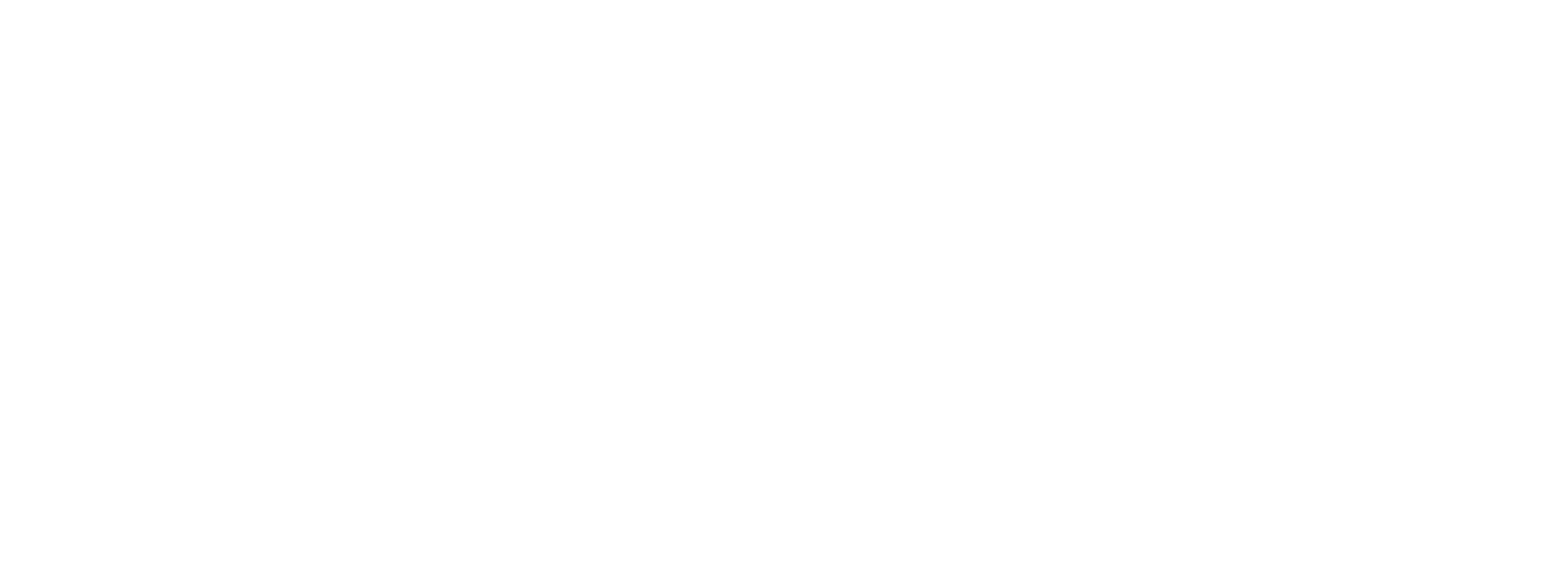Medienzeichen und Zeichen der Welt: Über getäuschte Wahrnehmungen
- Beitrag veröffentlicht:Dezember 9, 2014
- Beitrags-Kategorie:Kommunikation
Wir leben heute in einer Welt voller Zeichen und Konventionen. Wir haben Übereinkommen darüber getroffen, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Wir kommunizieren sozusagen durch die Zeichen, denen wir eine Bedeutung zuschreiben.
Zeichen als internationale Kommunikationsmittel
Wenn eine Ampel rot leuchtet, dann werden wir in den meisten Fällen vor einer Straßenkreuzung stehen bleiben. Selbst ein Mensch, der an Farbenblindheit leidet, wird es nicht wagen die Kreuzung zu überqueren. Er weiß nämlich, dass ROT sich an oberster Stelle einer Ampel befindet und er muss deshalb nur das Leuchten der Lampen erkennen, um die Bedeutung zu erkennen. In den meisten Ländern dieser Welt finden wir Ampeln mit folgender Anordnung: ROT oben, GELB (leuchtend) in der Mitte, GRÜN unten. Die Übereinkunft über diese Anordnung stellt die erste Bedingung dar, um die Zeichen einer Ampel lesen zu können. Die zweite Konvention besteht in der Bedeutungszuschreibung der Farben. Rot ist eine alarmierende Farbe, die uns sagt: „Halt, hier musst du stehen bleiben.“ Das gelb (blinkende) Licht interpretieren wir als Warnung: „Achtung, hier wird sich der Verkehrszustand in wenigen Augenblicken verändern.“ Das grüne Licht deuten wir als: „Jetzt kannst du gefahrlos weiterfahren.“
Keine Zeichen ohne Bedeutung
Wenn wir als Gesellschaft mit Zeichen kommunizieren wollen, müssen wir uns bezüglich ihrer Bedeutung einigen. Wenn sich zum Beispiel ein Land dazu entschließt, die Anordnung der Ampellichter kurzerhand zu verändern, könnte ein farbenblinder Mensch in arge Turbulenzen geraten. Wenn dann zusätzlich auch noch die Bedeutung der Farben verändert wird, hätten alle Verkehrsteilnehmer ein großes Proble, den Straßenverkehr unfallfrei zu bewältigen. Dann würden wir uns plötzlich in einer Umwelt befinden, in der uns die Bedeutung der Zeichen fremd ist. Zeichen müssen Bedeutungszuschreibung haben und damit von einer großen Allgemeinheit angenommen werden, damit wir durch sie kommunizieren können.
Zeichen als Täuscher
Wenn wir die Bedeutung der Zeichen verdrehen, gibt es zwei mögliche Konsequenzen. Entweder wir befinden uns im Chaos, so wie im Ampelbeispiel oder die Zeichen werden zu Täuschern unserer Wahrnehmung. Wenn wir einen Menschen mit teurer Markenkleidung sehen, glauben wir, dass es sich um einen sehr wohlhabenden Menschen handeln muss. Vielleicht ein erfolgreicher Geschäftsmann? Es könnte sich in Wirklichkeit aber auch um einen Menschen handeln, der mit seiner hochwertigen Kleidung nur einen wohlhabenden Menschen vortäuscht. Umgekehrt werden wir bei einem nackt durch die Gegend laufenden Menschen wohl eher einen Exhibitionisten, als einen sehr wohlhabenden Menschen vermuten. Trotzdem kann immer beides der Fall sein, weil Zeichen als „Täuscher“ auftauchen können und damit auch unser Wahrnehmungsverhalten steuern.
Schein und Sein in unseren Medien
Die fiktive Parallele zum Schein und Sein von Zeichen innerhalb unserer Medien finden wir im weltberühmten Märchen, Des Kaisers neue Kleider, von Hans Christian Andersen.
Die Hofbeamten wagen es nicht, dem Kaiser die Wahrheit zu erzählen und dass sie die neuen Kleider der beiden Webmeister gar nicht sehen können. Denn alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Schneider Experten in Sachen Mode sind und als Genies in ihrer Branche gelten. Die Hofbeamten glauben nicht an eine Täuschung der schlauen Betrüger, sondern sie zweifeln an ihrem eigenen Wahrnehmungsvermögen. Deshalb vertraut auch der Kaiser selbst in weiterer Folge nicht mehr seiner eigenen Wahrnehmung.
Erinnert uns das nicht auch ein wenig an das Asch-Experiment, über welches ich im letzten Beitrag geschrieben habe? Selbst der Kaiser fürchtete um seinen Geisteszustand und schwieg deshalb bis zur öffentlichen „Entblößung“ der optischen Täuschung, die im Grunde genommen keine Täuschung war. Die Betrüger haben die Wahrnehmungen des Kaisers und des Volks erfolgreich manipuliert, weil sie sich der notwendigen Zeichen bedienten um Zweifel über die eigene und zuverlässige Wahrnehmung herzustellen. Kurz: Wenn eine Majorität erst einmal konform in ihrer Wahrnehmung besteht, läuft die Minorität schnell in höchste Gefahr, sozial ins Abseits zu geraten oder noch schlimmer, um die eigene geistige Verfassung zu fürchten.