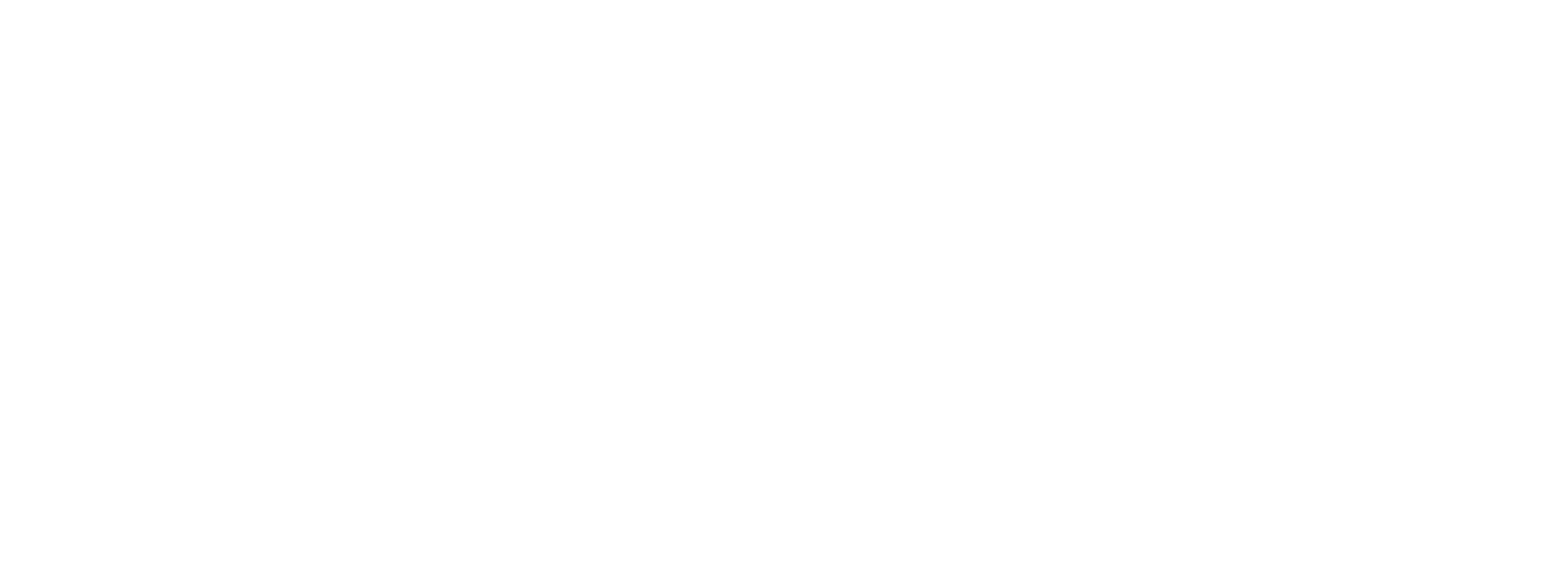„Nur ein Spiel“ – Kurzgeschichte
- Beitrag veröffentlicht:Oktober 21, 2022
- Beitrags-Kategorie:Mediendramaturgie

Regen klatscht auf die Windschutzscheibe und wieder sehen wir eine lange Schlange aufleuchtender Bremslichter vor uns. Es war ein durchgehend sonniges Herbstwochenende in Meran, weshalb wir jetzt die regnerische Heimfahrt, ständig unterbrochen durch stauenden Verkehr, mit Gelassenheit erdulden. Es ist der zweite Sonntag im Oktober und normalerweise wären wir jetzt schon auf der Lustenauer Kilbi, unserem jährlichen Kirchweihfest, das eigentlich ein großes Volksfest ist und nicht nur für uns Lustenauer ein Pflichttermin ist. „Heuer wird das wohl nix mehr“, denke ich in dem Moment, als ich nach kurzer Fahrt schon wieder die Bremslichtflut vor mir aufflackern sehe.
Dabei ist die „Luschnouar Kilbi“ weit mehr als ein großes Fest. Sie ist für die meisten Erwachsenen ein hoffnungsverheißender Treffpunkt, um lange vergessen geglaubte Gesichter wiederzusehen. Während ich wieder ein paar Meter durch den Regennebel auf dem Reschenpass dahinrolle, verspüre ich doch etwas Bedauern. Denn die Kilbi konnte heuer nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder einmal stattfinden. „So ein Pech und dann auch noch dieses miese Wetter. Kommt mir fast so vor wie in einem dieser Alpträume, in denen man unter Zeitdruck steht, um ein Ziel zu erreichen und nicht vom Fleck kommt“, fällt mir ein.
Unsere Kilbi ist nicht nur ein Familienfest oder ein bekannter Begegnungsort. Sie ist mit ihren bunten Marktständen, dem Treiben um die verschiedensten Fahrgeschäfte und dem geselligen Beisammensein vor allem auch für viele Kinder ein Fest wie Weihnachten. So war das auch bei mir und tatsächlich trage ich viele Kindheitserinnerungen von der Kilbi in mir. Erinnerungen an die verschiedensten sich abwechselnden Gerüche nach Käse und Zwiebel der Käsdönnala, heißen Maroni, aufplatzenden Bratwürsten, Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und jede Menge anderer Süßigkeiten. Wir Kinder bekamen meistens etwas mehr Taschengeld, „Kilbi-Geld“, um es dann kurzerhand für Spielzeug, Fahrgeschäfte oder Leckereien auszugeben. Das ist auch heute noch so und ich erinnere mich noch gut an jenen Sonntag, als ich mir ein beachtliches „Kilbi-Geld“ angespart habe.
Ich war damals etwa 12 Jahre alt und hatte 200 Schilling, heute etwa 14 Euro. Nicht besonders viel. Aber damals war das ein kleines Vermögen für mich und ich wollte es gut überlegt für ein besonderes Spiel ausgeben. Nicht irgendein Spiel, sondern das Spiel, das damals gerade der absolute Renner bei uns Kids war. „Das kaufmännische Talent“ oder kurz „DKT“ wollte ich schon lange selber haben, weshalb auch etwas kaufmännisches Talent nötig war, um es mir endlich kaufen zu können. Ein namhafter Spielehändler in unserem Ort hatte jedes Jahr an derselben Stelle seinen Stand auf der Kilbi und schon früh steuerte ich auf ihn zu. Manche Händler mochten es nicht gerne, wenn die Kinder zwischen ihren Waren herumfingerten. Aber dieser Spielzeughändler und die Verkäuferinnen kannten mich schon und ließen mich ihre Waren in Ruhe ansehen.
Das war aber auch eine Auswahl. Jede Menge verschiedenster Brettspiele, die natürlich genau beäugt werden mussten, obwohl ich genau wusste wonach ich suchte. Schnell habe ich das heiß ersehnte „DKT“ zwischen den Stapeln entdeckt und greife danach, um nach dem Preisetikett zu suchen. Ich erschrecke, als ich das gelbe Etikett des Händlers sehe: „188 Schilling. Wieviel ist das nochmals? Wie viele Fahrten mit dem Autoscooter gehen sich dann noch aus? Wieviel kostet nochmals eine Zuckerwatte? Ah ja, einmal auf die Schiffschaukel wollte ich ja auch noch. Das war doch nur ein Spiel und warum zum Kuckuck kostet es so viel.“ Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf und nervös kramte ich zwischen den zwei Hundertern in meiner Tasche. Wir Kinder schmissen unser Geld sonst meistens für günstigeres Ramschspielzeug, Plastikwaffen oder Kitsch raus. Nicht zu vergessen die begehrten Fahrten mit dem Autoscooter, die auch damals nicht billig waren. Und Naschereien wollte man sich auch noch gönnen. Aber diesmal wollte ich genau dieses Spiel, koste es was es wolle und so kaufte ich mir stolz das „DKT“. Mein restliches Geld habe ich dann doch noch mit einer Fahrt mit dem Autoscooter verputzt, weshalb ich dann auch schon etwas früher als gewöhnlich und völlig pleite von der Kilbi nach Hause ging. Diesmal ohne schlechtes Gewissen, weil ich so viel Geld für irgendeinen Blödsinn ausgegeben habe. Ich habe mir immerhin ein hochwertiges Brettspiel gekauft und als 12-jähriger geglaubt, ich würde ewig damit spielen.
Am nächsten Tag in der Schule hat uns ein Lehrer – wie alle Jahre wieder – nach unserem Tag auf der Kilbi gefragt. Nicht danach, was wir denn erlebt hätten. Er wollte von uns wissen, wieviel Geld wir ausgegeben haben. Es war genau die richtige Frage, um ein Kind vor versammelter Klasse zu diskreditieren. Logisch, dass er auch noch wissen wollte wofür wir unser Geld ausgaben. Nicht, dass es ihn etwas angegangen wäre und was ich ihm damals als Kind natürlich leider nicht sagen konnte. „Aber es war ja nur ein Spiel und kein Plastikgewehr um Krieg zu spielen“, dachte ich bei mir. So erhielt ein Schüler nach dem anderen seine Rüge von besagtem Lehrer. Dann war ich an der Reihe und erzählte stolz von dem tollen Spiel, das ich mir mit meinem hart ersparten „Kilbi-Geld“ kaufte. Er jedoch schüttelte nur den Kopf und tadelte mich, auf der Kilbi ein Spiel um 188 Schilling gekauft zu haben.
Noch gut erinnere ich mich an seine missfallenden Worte und wie ich ihn dafür verachtete. Ich besitze das DKT heute noch und habe das gelbe Preisetikett des Spielzeughändlers extra darauf kleben lassen. Es erinnert mich daran, wie stolz ich damals auf meinen Kilbi-Einkauf war. Und ich spiele auch heute noch gerne „DKT“. Meistens dann, wenn unser 12-jähriger Neffe bei uns zu Besuch ist und es erwartungsvoll aus dem Wohnzimmerkästchen zieht, damit wir es gemeinsam spielen.
Text: Bertram Holzer