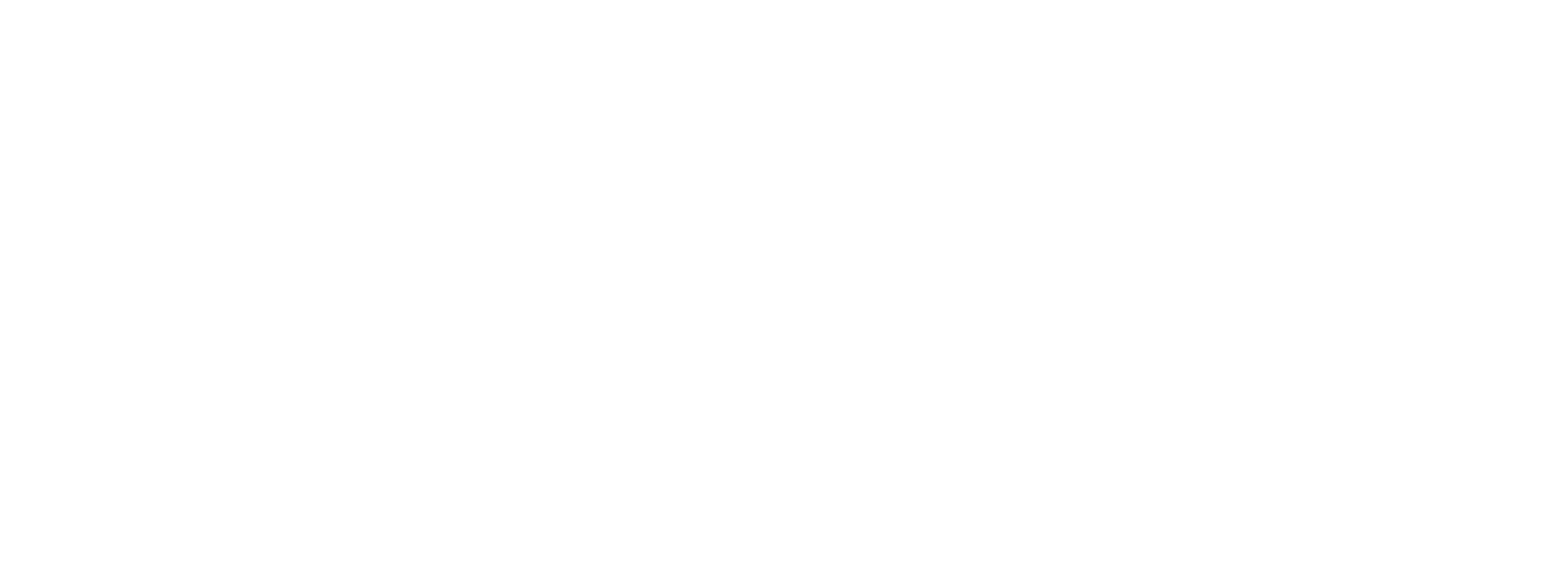Die jüngsten Ereignisse in Afghanistan erinnern mich daran, dass sich Geschichte wiederholt. Hoffnung auf Freiheit und ein menschenwürdiges Leben rücken erneut in weite Ferne. Dabei ist Schicksal von Geburt an bestimmt. – So lässt sich zumindest das Thema des Films „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ feststellen…
Bereits die ersten Bilder von Regisseurin Nadine Labaki spiegeln die sozialpolitischen Probleme des Libanon. Von Hoffnung also weit und breit keine Spur. In den Elendsvierteln Beiruts lebt der zwölfjährige Zain mit seiner Familie. Der junge Protagonist sagt schon zu Beginn, dass er sein Alter nicht kennt. Fehlende Identität und die damit verbundene Wertigkeit eines Lebens ziehen sich damit wie ein roter Faden durch die gesamte Handlung. Aber beginnen wir von vorne.
Zain steht vor Gericht. Er klagt seine Eltern an, weil sie ihn geboren haben und sie kein Recht haben sollten, ein weiteres Kind zu bekommen, um das sie sich nicht kümmern. Mit aller Brutalität erzählt die Regisseurin in Rückblicken die Geschichte eines Kindes, dessen Schicksal von Geburt an vorbestimmt war und jegliche Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben zum Scheitern verurteilt.
Ein Leben, das geprägt ist von Misshandlungen, Erniedrigung und dem täglich harten Überlebenskampf. Die Eltern sind damit beschäftigt, über ihre eigenen Kinder zu überleben und „verkaufen“ Zains minderjährige Schwester Sahar für eine Heirat mit dem skrupellosen Lebensmittelhändler Assad. Zain kann seine fast gleichaltrige Schwester nicht retten und flüchtet alleine. Weg von seinen Eltern und nur mit der schwach lodernden Hoffnung auf ein besseres Leben.
Auf einem Rummelplatz bleibt er hängen. Hunger, der gestillt werden muss und Arbeit, die nur schwer zu finden ist, verschlimmern seine Situation. Aber dann findet er Unterschlupf bei der äthiopischen Putzfrau Rahel. Auch sie befindet sich auf der Flucht, braucht eine Identität und benötigt deshalb Papiere, um für sich und ihren einjährigen Sohn Yonas die Hoffnung auf Leben zu wahren. Auch sie stößt von Geburt an auf ihr Schicksal, kämpft gegen Misshandlungen, Unterdrückung und den Erpressungsversuchen eines Menschenhändlers, der mit der Registrierung einer Ketchupflasche mehr Wertigkeit, als für einen Menschen ohne Identitätsnachweis empfindet.
Zain kümmert sich um den kleinen Yonas, glaubt, ein besseres Zuhause gefunden zu haben. Aber dann wird Rahel verhaftet. Wieder ist er alleine, muss für sich und den kleinen Yonas sorgen und wird schlussendlich zum Handel mit selbstgemischten Drogen gezwungen. Die „Geschäfte“ laufen zuerst gut, dann wird er von seinen Käufern geschlagen und vertrieben. Und als er eines Tages vor der verschlossenen Hütte steht, verliert er auch sein darin verstecktes Geld, das er für seine Flucht mit Yonas beiseitegelegt hat.
Sein Überlebenskampf geht von vorne los, spitzt sich wiederum zu und er muss als Höhepunkt den kleinen Yonas an den Menschenhändler verkaufen, um zu leben. Aber auch für seine Flucht benötigt er Papiere, die er nicht hat und die er auch in der Wohnung seiner Eltern nicht findet. Stattdessen erfährt er vom Tod seiner „verkauften“ Schwester, die auf den Stiegen eines Krankenhauses verblutet ist, weil auch sie keine Papiere hatte.
Ein Leben ohne Identität ist ohne Wert. Die Regisseurin schreibt den Eltern die Verantwortung für Identitätsstiftung zu, weshalb zum Schluss das allumfassende Thema des Films erfüllt wird: „Menschliches Schicksal ist von Geburt an bestimmt.“ Zain wusste das von Beginn an und sitzt deshalb im Gefängnis. Hoffnung auf ein besseres Leben gibt es nicht für alle Menschen.
Aber Zain erreicht mit dem Prozess gegen seine Eltern zumindest für einen Augenblick die Aufmerksamkeit einer großen Öffentlichkeit. Die Hoffnung auf Besserung bleibt, weshalb zum Ende der Fotograf – ohne es zu wissen – das einzige Mal ein zaghaftes Lächeln des jungen Protagonisten erfährt.
Pixabay-Bild: geralt