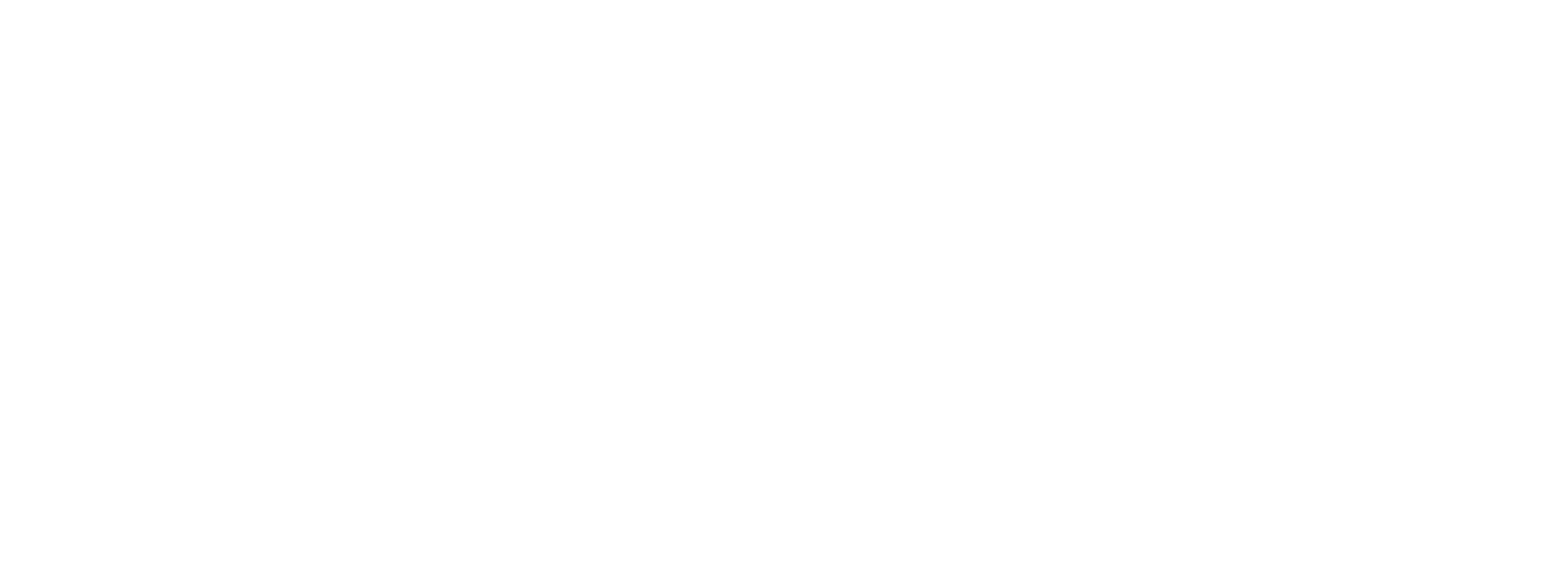E-Mail als Überwindungsmedium von Kommunikationsblockaden
- Beitrag veröffentlicht:Januar 18, 2015
- Beitrags-Kategorie:Unternehmensmedien
Das Internet und die neuen Kommunikationsmedien haben sich revolutionär auch in unserer Berufswelt etabliert. Kaum vorstellbar, wie wir heute ohne die Möglichkeiten von digitalen Medien unsere Korrespondenz bewältigen würden. E-Mail hat uns aber auch dahingehend trainiert, wie wir persönliche Gespräche im Geschäftsalltag vermeiden können. Bevor wir zum Telefonhörer greifen, schreiben wir eine E-Mail. Eine E-Mail zu schreiben geht schnell, viel schneller als das Schreiben eines Briefes und erreicht den Empfänger in einem Bruchteil von Sekunden. Außerdem sind wir bei E-Mails nicht an formalen Vorschriften gebunden, so wie sie für das Verfassen eines Briefes gelten und der Empfänger kann auf unsere Nachrichten sofort antworten. Es gibt bei E-Mail keine Portokosten und es können auch umfangreiche Dateien angehängt werden. Um es abzukürzen: Die vielen Vorteile dieser Kommunikationsform beweisen, weshalb sie sich so unverrückbar in unserer Welt verankert hat. Und trotzdem behaupte ich, dass wir mit dem Triumphzug der E-Mail auch ein großes Stück unserer persönlichen Kommunikationsfähigkeit aufgegeben haben.
Erst denken, dann sprechen
Unsere Eltern haben es uns (hoffentlich) oft gesagt: „Denke zuerst nach, bevor du sprichst.“ Kluge Menschen halten an diesem Prinzip fest, wenn sie nicht absichtlich ihrem Frust freien Lauf lassen wollen. Wer aber erfolgreich im Beruf sein möchte, darf nicht ständig das sagen, was er wirklich denkt. Seltsamerweise neigen wir aber dazu, in einer „schnellen E-Mail“ schlampig mit unseren Formulierungen umzugehen. Zeit ist Geld und alles muss schnell gehen, vor allem Kommunikation. Sprache ermöglicht uns auch mit relativ wenig Zeitaufwand die wesentlichen Dinge gezielt auf den Punkt zu bringen. Mit Schreiben ist das so eine Sache. Eine schriftliche Botschaft wird viel öfter mehrdeutig interpretiert und erzwingt deshalb Rückfragen des Empfängers. Dadurch entstehen dann wiederum die bekannten „Kettenmails“, die sich nicht nur zwischen den ursprünglichen Sendern und Empfängern verzweigen: Nachricht – Antwort mit Rückfrage – Antwort zur Rückfrage – Nochmals eine Rückfrage, diesmal mit einem Dritten in „cc“ – Nachfassen dieses Dritten bei den ursprünglichen Sendern und Empfängern …
Wir kennen diese E-Mails, die plötzlich so ziemlich das ganze Unternehmen beschäftigen und dabei ständig an den ursprünglich benötigten Informationen vorbeizielen. Dabei wäre es doch so einfach, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und das persönliche Gespräch zu suchen, um unmissverständlich die Anliegen zu formulieren. Trotz des Mehraufwandes sämtliche E-Mails zu verfassen und zu beantworten, herrscht eine persönliche Kommunikationsblockade vor. Und dabei ist die E-Mail doch auch nur ein Brief mit einem Absendernamen und verstecken in eine vermeintliche Anonymität.
Erst mal liegen lassen: E-Mail bedeutet Prioritäten setzen
Kein Wunder also, dass E-Mail gar nicht ein so schnelles und immer praktikables Medium ist. Sehr oft wird durch die Vermeidung persönlicher Kommunikation eine wahre E-Mail-Flut erreicht, die es dann zu bearbeiten gibt. Die Lösung von der strikten E-Mail-Kommunikation wird oft durch die Möglichkeit des „Aktenvermerks“ gerechtfertigt. Mündliche Vereinbarungen sind gut, schriftliche Nachweise in Form von E-Mails sind besser. Das stimmt und darin besteht einer der wichtigsten Vorzüge von E-Mail. Trotzdem differenzieren wir nicht zwischen den Vor- und Nachteilen. Dafür können wir bei E-Mail sehr deutlich eine Differenz beobachten, die es zum Beispiel bei einem Gespräch nicht gibt: Bequemlichkeit und Zwang.
Denn nahezu zwanghaft hängen wir an unseren Handys. Erreichbarkeit beherrscht manche Menschen sogar bis zum Toilettengang. Treffpunktvereinbarungen müssen nicht mehr im Vorhinein getroffen werden. Man trifft sich vor Ort und Stelle mit dem Kommunikationsmittel Handy. Das ist sehr bequem.
E-Mail funktioniert in einem Punkt etwas anders. Im Geschäftsalltag werden nicht alle E-Mails sofort bearbeitet. Wir selektieren die Nachrichten nach Prioritäten. Das bedeutet auch, dass wir erst gar nicht versuchen sämtliche Mails sofort zu beantworten. Es gibt auch Mitarbeiter, die wichtige Nachrichten gezielt einige Zeit unbeachtet lassen, um damit ihre eigene Auslastung zu unterstreichen: „Wer sofort auf alles antwortet, ist an seinem Arbeitsplatz nicht genügend ausgelastet.“ Ein anderer Typus praktiziert die gegenteilige Strategie und unterwirft sich dem Zwang des sofortigen Antwortens, weil er damit möglichst viel Arbeit erledigt haben möchte: „Hauptsache die Mails werden beantwortet oder weitergeleitet, damit ich Ruhe habe und mich mit meinen eigentlichen Kernaufgaben beschäftigen kann.“
Aber bei beiden Verhaltensweisen bleibt schlussendlich die Pflicht, irgendwann die empfangene Nachricht zu bearbeiten.
E-Mail-Korrespondenz als lästiger Zwang
Wer längere Zeit im Urlaub war, ärgert sich nicht selten über einen überfüllten E-Mail-Eingang, der ihn nach seiner Rückkehr erwartet. Die Bearbeitung wird häufig als lästig, als Zwang empfunden, der nun so schnell wie möglich überwunden werden muss. Aber auch dann würden sich durch persönlichen Telefonkontakt viele Dinge sehr viel schneller und mit weniger Aufwand erledigen lassen. Die sprachliche Kommunikation gelingt uns naturgemäß einfach besser als die schriftliche, vor allem wenn wir nicht die Talente eines großartigen Schriftstellers besitzen.
Freilich kann mit E-Mail eine vorherrschende Distanz im Kommunikationsprozess überwunden werden. Aber der Glaube, dass wir durch Anonymität Blockaden abbauen ist ein Trugbild, genauso wie die Anonymität in den sozialen Netzwerken nur eine Täuschung ist. Ich bin in einem Netzwerk und mit E-Mail nicht weniger anonym wie am Telefonhörer, setze mich selbst aber der Gefahr aus, dem Lockruf falscher Spuren zu folgen und Missverständnisse zu reproduzieren. Über diese „falschen Spuren“, die mit der E-Mail-Kommunikation im Geschäftsalltag zwangsläufig verbunden sind, erfahren Sie im nächsten Beitrag mehr.