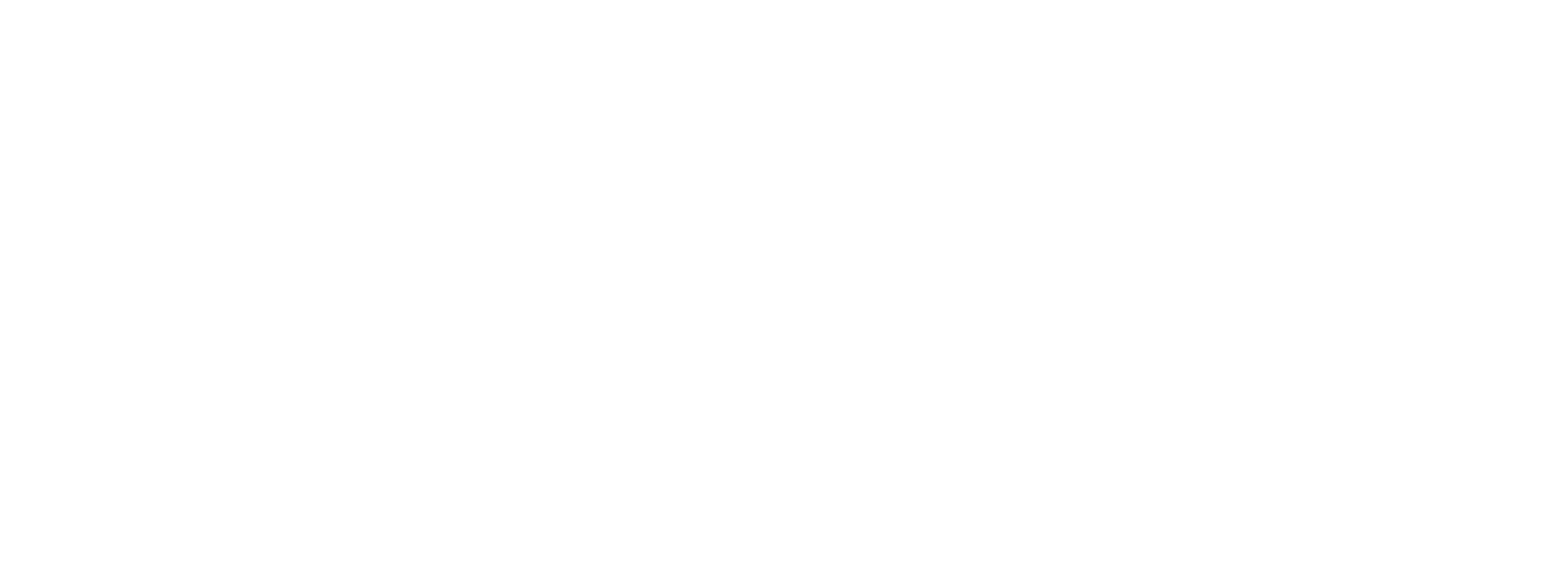„Erinnerung“ – Kurzgeschichte
- Beitrag veröffentlicht:Februar 18, 2022
- Beitrags-Kategorie:Mediendramaturgie

Es sind bereits viele Jahre vergangen, als ich in Wien lebte und arbeitete. Aber noch heute fällt mir ein schaudererregendes Erlebnis in der U-Bahn ein.
An jenem Tag habe ich abends etwas früher Schluss gemacht und ich wurde in meiner Hoffnung nicht enttäuscht, mich diesmal nicht in eine überfüllte U-Bahn quetschen zu müssen. Im Gegenteil und obwohl mir etwas Stehen ganz gutgetan hätte, setzte ich mich auf einen der freien Plätze. Ich sah mich um, meine Aktentasche auf dem Schoss. Nur wenige Leute im Abteil und trotzdem dieser penetrant muffige Gestank menschlicher Ausdünstung und zwiebelhaltigem Fastfood, das hier soeben jemand gegessen hatte.
Ich sehe eine dicke Frau mit ihrem kleinen Sohn vor mir. Sie ist offensichtlich überfordert, den quirligen Jungen in Zaum zu halten. Ein junger Mann mit Hoodie sitzt mir gegenüber und reißt an der Leine seines Hundes, der am Boden liegt. Weiter vorne sitzt ein etwas älterer Mann, der mich freundlich angrinst. Ich lächle etwas verunsichert zurück, bin mir nicht sicher, ob seine Geste tatsächlich mir gilt. Der Mann erinnert mich an jemanden, aber ich weiß nicht an wen. „Passiert mir öfter“, denke ich kurz. Man kann sich an einem fernen Ort befinden und sieht plötzlich jede Menge Doppelgänger von Menschen, die man von zuhause kennt.
Dann entdecke ich vier Menschen, die im Abteil beieinandersitzen und sich amüsiert unterhalten. Ich staune nicht schlecht, als ich einen von ihnen tatsächlich zu kennen glaube. Ich sehe nochmals genauer hin und täusche mich nicht. Andreas Vitasek sitzt bei ihnen und unterhält sich entspannt mit den Fahrgästen. „Sympathischer Typ“ denke ich, als er sich freundlich von ihnen verabschiedet, um in der nächsten Station auszusteigen. Der Zug hält und nur wenige Menschen steigen zu.
Die Fahrt geht weiter, der Hund, der gegenüber von mir am Boden liegt, bleibt ruhig liegen und sein junger Besitzer hat endlich damit aufgehört, an der Hundeleine zu reißen. Die dicke Frau schnorrt immer noch mit ihrem überaktiven Kind, das mich im Gegensatz zu der Mutter überhaupt nicht mehr nervt. Mein Blick trifft wieder den freundlich grinsenden Blick des älteren Mannes. „Verdammt nochmal. An wen erinnert mich dieser Mensch bloß. Kenne ich ihn womöglich doch? Einen Prominenten erkennt man doch auch sofort.“
Der junge Mann mit Hoodie reißt plötzlich wieder an der Leine und schreckt damit das schlafende Tier auf. „Blöder Hund“ denke ich und meine damit diesen Typen, der die Kapuze noch tiefer über seine Stirn zieht, um ebenfalls ein Nickerchen zu machen. Auch die dicke Frau reißt ihr Kind zum wiederholten Mal an sich und ermahnt es, endlich still zu sitzen. Der ältere Mann lächelt wieder zu mir rüber, nickt mir abermals freundlich zu. Ich überlege aufzustehen, um zu ihm rüberzugehen und ihn zu fragen, ob wir uns kennen.
Im selben Augenblick stört das schrille Läuten meines Handys die Ruhe im Abteil. Schnell ziehe ich es aus meiner Tasche, stelle es lautlos und sehe die Nummer eines Freundes auf dem Display. Ich wundere mich, denn sein Anruf um diese Zeit hat schon früher schlechte Nachrichten bedeutet. Erwartungsvoll nehme ich den Anruf an. Der Zug fährt mittlerweile in das Tageslicht der nächsten Haltestation ein und am anderen Ende der Leitung höre ich die traurig schluchzende Stimme meines Freundes. – Sein Vater ist tödlich verunglückt.
Erschrocken stammle ich herum, blicke verstört aus dem Fenster. Mir fehlen die richtigen Worte aber ich versuche ihn dennoch zu trösten, als der Zug erneut Fahrt aufnimmt. Die Verbindung wird nicht mehr lange anhalten und ich vergesse mein Umfeld, während der Zug wieder in die unterirdische Dunkelheit der nächsten Tunnelröhre schießt. Flackerndes Licht und Dunkelheit im Abteil wechseln einander ab. Dann bricht die Verbindung ab.
Gedanken rasen durch meinen Kopf: „Sein Vater, so ein netter Mann und jetzt ist er tot?“ Plötzlich bemerke ich, dass der freundlich blickende Mann nicht mehr im Abteil sitzt. „Wann ist er verschwunden?“ Und dann lässt mich eine Erinnerung an den Vater meines Freundes erschaudern, denn im selben Augenblick fällt mir ein, weshalb mir der freundliche Fremde so bekannt vorkam?
Text: Bertram Holzer